Blick über den Tellerrand
Lebensgespräche e.V. ist nicht das erste Projekt, das sich dem Ziel verschrieben hat, lebensgeschichtliche Erinnerungen zu bewahren. Insbesondere in den angelsächsischen Staaten gibt es eine recht lange Tradition so genannter "oral history". Der Begriff beschreibt eine Methode der Geschichtsforschung, in deren Zentrum die Sammlung und Auswertung von Zeitzeugenerzählungen steht. Sammlungen lebensgeschichtlicher Erinnerungen sind dabei häufig thematisch oder lokal begrenzt. Thematisch definierte Sammlungen in Deutschland sind zum Beispiel das Archiv "Zwangsarbeit 1939-1945" der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" oder das Archiv "Deutsches Gedächtnis" am Institut für Geschichte und Biografie der Fernuniversität Hagen mit den Schwerpunkten Arbeitergeschichte und politische Verfolgung.
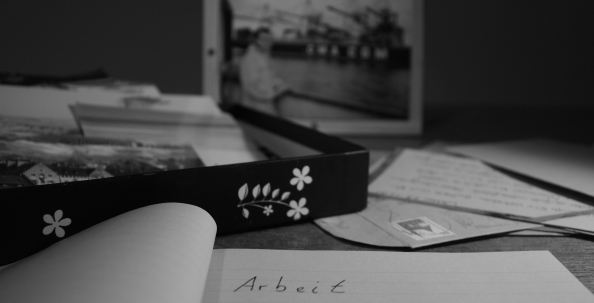
Einen lokalen Schwerpunkt setzen dagegen Stadtteilarchive, die Menschen aus ihrem Viertel über das Leben in ihrem Viertel befragen. Ein Zugang zu diesen Zeitzeugen-Archiven wird häufig nur auf Grundlage eines begründeten (meist wissenschaftlichen) Interesses gewährt.
Das Internet hat in den vergangenen Jahren auch eine Reihe frei zugänglicher Zeitzeugen-Archive hervorgebracht. Beispiele für diese Entwicklung sind das migrations-audio-archiv, das Erzählungen von Einwanderern präsentiert, und das vom Haus der Geschichte in Bonn betriebene Zeitzeugen-Portal. Einen noch radikaleren Weg gehen Erzählplattformen, auf denen Zeitzeugen eigene Video- und Audioclips mit ihren lebensgeschichtlichen Erinnerungen hoch laden können. Jeder Internetnutzer hat freien Zugang zu den Inhalten der Archive. Ein Beispiel hierfür ist das internationale Memoro Projekt.
Sie sehen, dass es eine Vielzahl an Ansätzen gibt, Lebenserinnerungen zu bewahren. Lebensgespräche e.V sieht sich nicht in Konkurrenz zu diesen Projekten, sondern begreift das Sammeln von Erinnerungen als eine große, gemeinsame Anstrengung. Die unterschiedlichen Schwerpunkte führen dazu, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden.